DIE KUNST DES THERAPEUTISCHEN SCHEITERNS
ES GIBT VIELE verschiedene Wege, mithilfe von Psychotherapie erfolgreich zu sein und so das erlebte und empfundene Leid von Menschen zu verringern. Es gibt aber auch einige Möglichkeiten, wie wir irreversibel scheitern können. Dazwischen befindet sich ein schmaler Pfad, den ich kontrolliertes Scheitern nenne, auf dem ein Manövrieren gerade noch möglich ist. Manchmal ist es für einen guten Therapieverlauf notwendig, sich in diese Grenzbereiche vorzuwagen, manchmal weist ein Scheitern auf eine bereits überschrittene Grenze hin. Im Folgenden möchte ich den Kreislauf von Erwartungen und Enttäuschungen, den Umgang mit Abbrüchen, den Erwerb negativen Wissens sowie Risiken und Fallstricke im psychotherapeutischen Prozess darstellen. Anhand zweier Fallgeschichten soll der Unterschied zwischen notwendigem und kontrolliertem Scheitern verdeutlicht werden.
Eine praktische Ärztin überwies einen jungen Mann mit Ängsten vor einer lebensbedrohlichen Krankheit in meine Praxis, den sie nach fachärztlicher Abklärung für organisch gesund befand. Am Telefon wies sie mich darauf hin, dass der plötzliche Herztod seines Vaters vor 16 Jahren möglicherweise in Verbindung zu den Ängsten stehen könnte. Der Mann und mit ihm die behandelnden Fachkräfte befanden sich nun in einer Zwickmühle. Überzeugt davon, an einer noch nicht diagnostizierten Krankheit zu leiden, suchte er seine Hausärztin auf, die ihn zur Psychotherapie schickte, da sie meinte, ein zurückliegendes Trauma läge seinen Ängsten zugrunde. In der Psychotherapie wollte er jedoch seine Ängste nicht behandelt wissen, da sie seiner Meinung nach auf einer organischen Krankheit beruhten. Erst nach 3 Sitzungen und 9 ärztlichen Konsultationen beendete er selbst diesen Kreislauf. In der Nachbetrachtung wurden mir diese Schleifen schmerzlich klar. Es gab jedoch keine Möglichkeit mehr, diese Betrachtung in den Prozess miteinfließen zu lassen.
Ever tried. Ever failed. No Matter. Try again. Fail again. Fail better.“
Samuel Becket
In Anbetracht der Wahrscheinlichkeit von Abbrüchen bzw. als nicht hilfreich bewerteten Verläufen – der Schnitt diverser Untersuchungen ergibt einen Wert zwischen 30 und 40% – ist Psychotherapie eine hochriskante Angelegenheit, und es macht vorsorglich und in der Nachbetrachtung Sinn, sich mit dem allgegenwärtigen Misslingen der Bemühungen aller direkt oder indirekt am Prozess Beteiligten zu befassen mit dem Ziel, eine Kultur des Scheiterns für die eigene Praxis zu entwickeln, die uns nicht entmutigen, sondern letztlich klüger, umsichtiger und nachsichtiger machen soll. Analog zur bekannten These von Albert Camus (1965): „Wir müssen uns Sisyphos als gluücklichen Menschen vorstellen!“, könnten wir als PsychotherapeutInnen lernen, erfolgreich zu scheitern. Doch zuerst zu den Begriffen: Scheitern ist vom deutschen Wort Scheit abgeleitet und bedeutet das Zusammenbrechen eines aus Holz errichteten Gebäudes oder Schiffes, des „zu Scheitern“ Werdens. Die häufig verwendete Metapher „Schiffbruch erleiden“ weist auf diese ursprüngliche Bedeutung hin. In stärker romanisch geprägten Kulturen steht ursprünglich das „Fallen“ für die spätere sinnbildliche Bedeutung (lat. fallere; ital. fiasco; franz. faillite; engl. to fail, the fall). Während das deutsche Wort eher die Erfahrung, an einer Aufgabe zu scheitern, oder das Misslingen meint, bedeutet „Fallen“ eher das Scheitern als Person im Sinne des persönlichen Versagens oder Verlierens. Beide Erfahrungen gehen z. B. beim Abbruch eines Therapieverlaufs oft Hand in Hand, was sowohl eine Verarbeitung der emotionalen Folgen, als auch eine Bearbeitung des misslungenen Unterfangens erforderlich machen würde.
AUSGEHEND VON MEINEN beruflichen Beobachtungen von Beziehungs-, Arbeits- und Lebensverläufen und angeregt durch eigene Erfahrungen des Scheiterns, bin ich mittlerweile zu der Überzeugung gelangt, dass wir „nur“ an unseren Erwartungen scheitern bzw. am Versuch, diesen gerecht werden zu wollen oder sie von anderen erfüllt zu bekommen. Wir scheitern demnach nicht an Situationen, Aufgaben oder Beziehungen, sondern an den damit verbundenen eigenen Erwartungen – an uns oder an andere – bzw. an den Erwartungen anderer an uns selbst, die wir uns zu eigen gemacht haben.

Bewusstes oder kalkuliertes Scheitern, wie ich es verstehe, setzt eine Bereitschaft voraus, uns selbst und anderezu enttäuschen oder von anderen enttäuscht zu werden. Diese Risikobereitschaft hebt sich von dem sicheren alltäglichen Erfüllen des Gewohnten und Absehbaren abund nimmt dabei etwaig bevorstehende Enttäuschungenin Kauf. Ein Gutteil unserer Versuch- und Irrtumsschleifen inder psychotherapeutischen Begleitung könnte somit als „kontrolliertes Scheitern“ verstanden werden, ebenso wie das Gehen „kontrolliertes Fallen“ beschreibt: wirlernen erst das Stehen, dann das Fallen, dann das Kontrollierendes Fallens; oder wie Schwimmen, das sich alskontrolliertes Untergehen realisiert – im Wasser verlieren wir zuerst die Angst vorm Untergehen, dann lernen wir das Untergehen, gekoppelt mit dem kontrollierten Wiederauftauchen. Gute Therapie gelingt, wenn sie auch scheitern darf: letztlich sogar an der Beziehung, denn sie soll sich wiederauflösen dürfen; an unseren Annahmen, denn siesollen durch die eigenen Vorstellungen von KlientInnen abgelöst werden und an der Gestaltung von Veränderung, denn die Verantwortung dafür sollte in ihre Handgegeben werden. Wenn es gelänge, in der Ausübung von Psychotherapieeine nicht anklagende Form der Betrachtung von unerwartetenund unerwünschten Prozessen zu (er-)finden, könnten diese als ebenso wertvoll erachtet werden wie die gelingenden. Dies würde eine Haltung voraussetzen, die Marshall Rosenberg (2005) als „non violent“ – gewaltlosoder gewaltfrei – bezeichnet. Um dorthin zu gelangen,sollten wir, seinem Ansatz folgend, die mit einer unerwünschten Situation verbundenen Gefühle und Gedanken benennen können, diesen nicht erfüllte Bedürfnisse oder Werte zuordnen und schließlich konkrete Wünsche an uns oder ein Gegenüber formulieren, begleitet durch eine wertschätzende Beziehung zu unsselbst, um die Enttäuschung auszuhalten.
Von allen Fehlern, die wir machen, ist unsere Vorstellung von Fehlern wohl unser größter Fehler
Kathryn Schulz
FEHLBARKEIT IST FÜR MICH KEIN ZEICHEN von Schwäche oder Unwissenheit, sondern unverzichtbarer Bestandteil der für die Ausübung von Psychotherapie notwendigen Anstrengungen in Empathie und forschender Kreativität.
In der bekannten Untersuchung „der zweiarmige Bandit“ mit Studierenden am MRI der Universität von Palo Alto beschrieb Paul Watzlawick, wie schnell Menschen kausale Erklärungsmodelle rund um das Funktionieren trivialer Maschinen entwickeln, auch – oder gerade – wenn keine Anhaltspunkte dafür gegeben sind.
Als den interessantesten Teil der Studie fand ich die Erwähnung, dass mehr als 50 % der ProbandInnen an ihren Modellen festhielten, obwohl ihnen von der Versuchsleitung mitgeteilt wurde, dass der Arbeitsweise der Maschine keinerlei Gesetzmäßigkeit unterlag. Dieses Phänomen, das unserem Erkennen und Auswerten von Fehlern diametral entgegenwirkt, wird in der Kognitionsforschung übermäßiges Selbstvertrauen“ (overconfidence)
genannt.
Was könnte uns noch daran hindern, Fehler anzuerkennen, um in dem so sensiblen Gefüge Psychotherapie in der Lage zu sein, Prozess und Beziehung selbstkritisch zu reflektieren und rechtzeitig gegenzusteuern, bevor alles aus dem Ruder läuft?
Die US-amerikanische Psychologin Kathryn Schulz (2010) nennt zwei simple Gründe für unsere fehlerhafte Fehlerkultur: Erstens, dass es sich so gut anfühlt, recht zu haben und zweitens, dass es unangenehm ist, unrecht zu haben, jeweils verknüpft mit entsprechenden körperlichen und psychischen Begleitsymptomen wie erhöhtem Herzschlag oder Blutdruck, Schwitzen, Gesichtsröte, Schlafstörungen, Ärger über die Gedankenlosigkeit oder Nachlässigkeit, Scham- oder Schuldgefühle, Selbstvorwürfe, Selbstzweifel, depressive Symptome, das Gefühl allein oder isoliert zu sein, Gefühle von Ohnmacht sowie einer allgemeinen Verunsicherung, die ich als Versagensangst oder fehlendes Selbstvertrauen auch auf andere Bereiche übertragen kann. Wer will sich schon frustriert, entmutigt oder schuldig fühlen? Die Erfahrung des unwiederbringlichen Scheiterns als PsychotherapeutIn bzw. das Gefühl, versagt oder nicht genug getan zu haben, um beispielsweise einen Abbruch zu verhindern, löst meiner Erfahrung nach auch häufig Scham, Ärger, Wut, Angst, Trauer, Ohnmacht oder zumindest eines dieser Gefühle in unterschiedlicher Intensität aus. Nicht selten jedoch vergraben oder verdrängen wir diese Emotionen oder agieren sie in Form von Selbstvorwürfen, Selbstmitleid, Verleugnung oder Schuldzuweisungen aus. Manchmal führt ein Ärgeroder eine Kränkung auch zu Beschuldigungen und stillen Vorwürfen an KlientInnen wie die Zuschreibung von Veränderungsresistenz, fehlende Kooperation oder Undankbarkeit. Wenn wir auch noch stark mit therapeutischem Erfolg identifiziert sind, werden wir ein Scheitern möglicherweise schwer ertragen. Nachdem wir regelmäßig unseren KlientInnen die Angst vor starken Affekten nehmen, könnten wir uns doch auch von unserem TherapeutInnen-Selbst an der Hand nehmen lassen, uns ein wenig Trost spenden und dabei helfen, alle Reaktionen der leidvollen Erfahrung zuzuordnen und anzunehmen – wie in einem stufenhaften Trauerprozess, an dessen Ende die Integration des Erlebten steht. Auf den emotionalen könnte ein inhaltlicher Verarbeitungsprozess folgen, in dem wir gedanklich von der Herstellung über die Verwirklichung bis zur Auflösung alle Elemente der therapeutischen Dynamik reflektieren und auswerten, sodass am Ende ein differenzierteres Bild vom Zusammenspiel des Wollens, Sollens und Könnens aller Beteiligten steht. Letztlich ist therapeutisches Scheitern ein Fakt, wir können nur lernen, besser zu scheitern.
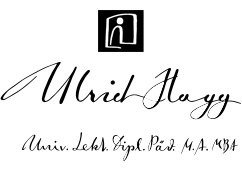



No Comments